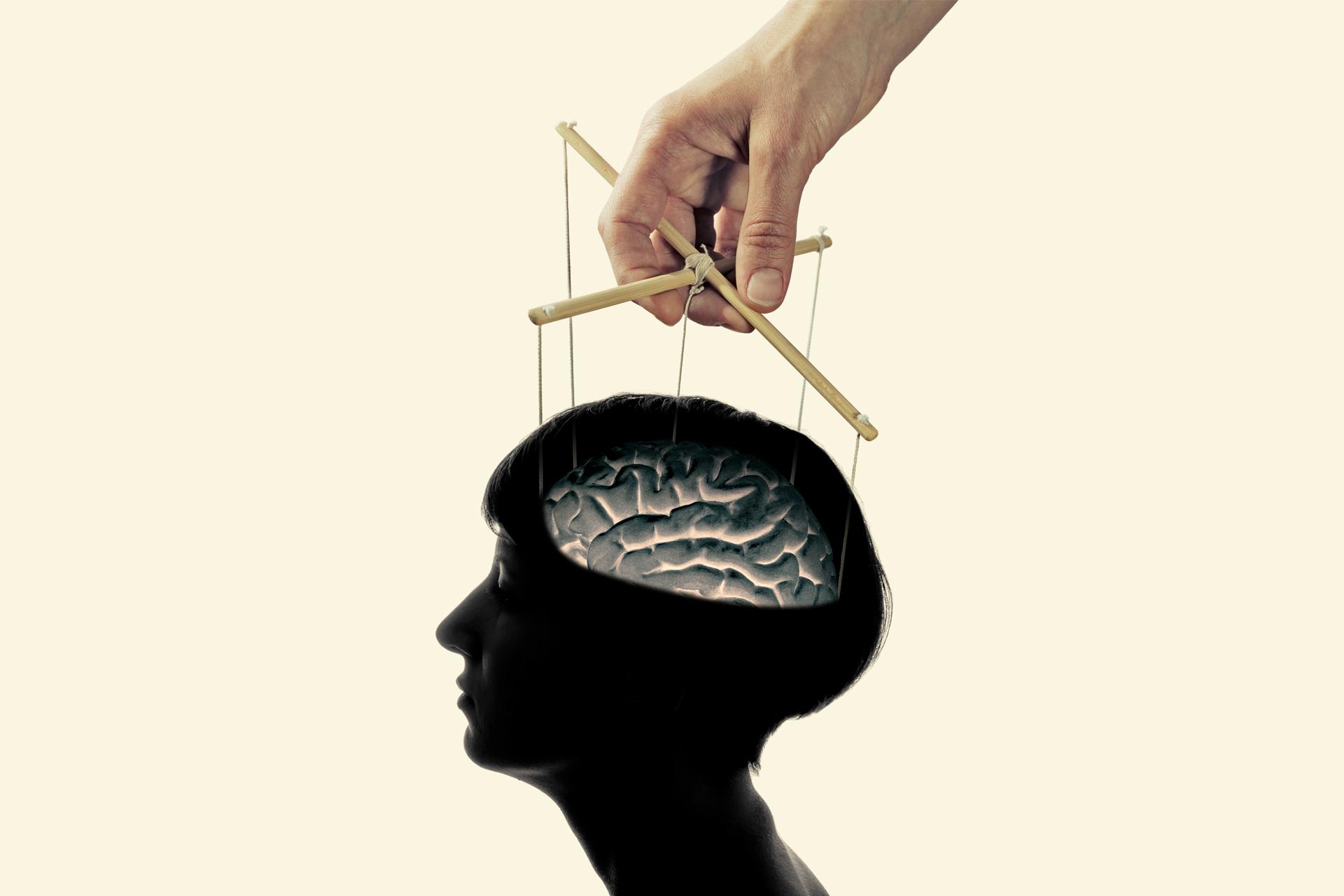– von Dr. Tobias Faix
Wir leben in einer Zeit, die von vielen Menschen als zunehmend bedrohlich und unsicher wahrgenommen wird. Gerade Kirche und Gemeinde sollten in solchen Zeiten als sicherer Zufluchtsort dienen, allerdings haben die Skandale der vergangenen Jahrzehnte gezeigt, dass dies häufig leider nicht der Fall war und ist. Deshalb ist es notwendig, dass wir klar und selbstkritisch in unseren Gemeinden auch schwere Themen ansprechen. Eines dieser Themen ist »geistlicher Missbrauch«.
In diesem Artikel soll es darum gehen, ein erstes Verständnis von geistlichem Missbrauch zu bekommen, Gemeinden zu ermutigen, das Thema präventiv anzugehen und Missbrauch im eigenen Umfeld überhaupt für möglich zu halten.
Die Ausübung von Macht und Kontrolle im gemeindlichen Kontext
Geistlicher Missbrauch beschreibt die Ausübung von Macht und Kontrolle durch eine Person, die ihre Autorität missbraucht, um andere emotional, psychisch und/oder geistlich zu manipulieren und zu schädigen. Besonders im gemeindlichen Kontext geschieht dies häufig durch die bewusste oder fehlerhafte Interpretation biblischer Lehren sowie ein manipulatives Gehorsams- und Unterordnungsverständnis, das Abhängigkeiten erzwingt.1 Die Auswirkungen für die Betroffenen sind tiefgreifend und können zu psychischen Verletzungen und Traumata, Vertrauensverlust in Gemeinde sowie zu einer Entfremdung vom eigenen Glauben führen. Bei geistlichem Missbrauch handelt es sich also immer um emotionalen Machtmissbrauch im religiösen Zusammenhang.2 Inge Tempelmann unterscheidet dabei zudem zwischen unbewussten und bewussten Formen, da sowohl absichtliche als auch unbeabsichtigte Handlungen zu geistlichem Missbrauch führen können.
Hinzu kommt, dass geistlicher Missbrauch oft schwer zu erkennen ist, da er häufig unter dem Deckmantel der Fürsorge oder des geistlichen Wohlwollens stattfindet.
Die Betroffenen befinden sich oft in einer schwierigen Situation, da es ihnen schwerfällt, den Missbrauch zu benennen und sie oft das Gefühl haben, dass ihr Glaube oder ihre christliche Gemeinschaft sie im Stich lassen könnten, wenn sie ihn thematisieren. Dazu kommen Fragen und Selbstzweifel wie »Und wenn Gott das jetzt so will?« oder »Aber die Leitung wurde doch von Gott eingesetzt?«. Bei diesen Fragen wird schon deutlich, wie komplex die Fragestellung ist und wie alle Beteiligten oft in und aus bestimmten Hierarchien denken und handeln.
Merkmale des geistlichen Missbrauchs
Geistlicher Missbrauch kann sich in unterschiedlichen Formen manifestieren. Einige sollen hier aufgezeigt werden:
- Manipulation durch biblische Lehren: Durch den Missbrauch biblischer Lehren wird versucht, das Verhalten oder Denken anderer zu beeinflussen, oft indem Angst, Schuldgefühle oder Scham erzeugt werden. Theologien und (meist männliche) geistliche Leiter, die monokratische Prinzipien vertreten (z. B. »den Leitern unwidersprochen folgen«, weil diese von Gott berufen sind) finden sich gerade in neocharismatischen Gemeinden.
- Kontrolle über persönliche Entscheidungen: Ein weiteres Beispiel ist die Kontrolle über wichtige Lebensentscheidungen der Gemeindemitglieder. Geistliche Autoritäten können versuchen, die Entscheidungsfindung stark zu beeinflussen, indem sie behaupten, allein über göttliche Weisheit zu verfügen. Dies kann das persönliche Wachstum und die Selbstständigkeit der Mitglieder erheblich einschränken. Dies gilt besonders für den Bereich Sexualität und Partnerschaft. Aber auch ganz subjektive Berufungen gehören dazu wie: »Gott hat mir gesagt, dass du in die Mitarbeit gehen sollst.«
- Erzeugung von Angst und Schuld: Drohungen mit göttlicher Strafe oder ewiger Verdammnis werden häufig eingesetzt, um Kontrolle über die Gemeinschaft oder einzelne Mitglieder zu behalten. Durch die Erzeugung von Angst wird Druck auf die Einzelnen ausgeübt, bestimmte Verhaltensweisen zu übernehmen oder in der Gemeinde zu bleiben, auch wenn sie sich unwohl fühlen.
- Isolierung von der Außenwelt: In manchen Gemeinschaften wird der Kontakt zu Außenstehenden unterbunden, um die »Reinheit« des Glaubens zu bewahren. Diese Isolationstaktiken verstärken die Kontrolle über die Mitglieder und schneiden sie von anderen Meinungen oder Unterstützung ab. Oftmals wird ein dualistisches Weltbild gelehrt, dass zwischen den Guten im Reich Gottes und der Gemeinde und dem Schlechten in der bösen Welt unterscheidet. Bei Streit darf dann nicht ein weltliches Gericht angerufen werden, weil dies der Sache schadet, wie es in 1. Korinther 6 steht.
- Abschottung von externer Hilfe oder Heilung: Geistlich einflussreiche Personen könnten Gemeindemitgliedern, die mit psychischen oder gesundheitlichen Problemen kämpfen, davon abraten, professionelle ärztliche Hilfe zu suchen und stattdessen auf Gebet und spirituelle Disziplin als alleinige Lösung verweisen. Dies kann zu einer Verschlechterung der Gesundheit und des Wohlbefindens der Betroffenen führen.
- Geistliche Autoritäten nutzen ihre Position, um das Leben anderer in übermäßiger Weise zu überwachen oder zu bestimmen, wodurch die persönliche Freiheit und Entscheidungsfähigkeit eingeschränkt werden. Persönlichkeiten in Leitungspositionen, die narzisstische Züge haben und sich selbst von Gott eingesetzt sehen, um an seiner Stelle zu handeln, verwechseln dabei sich und die eigene Macht mit Gott und Narzissmus mit dem Heiligen Geist.
Oftmals kommen bei »geistlichem Missbrauch« mehrere solcher Merkmale zusammen.
Zusammenhang zwischen Strukturen, Theologien und Machtmissbrauch
Geistlicher Missbrauch ist also häufig eng mit Strukturen und Theologien verbunden, die es einzelnen Personen ermöglichen, übermäßige Macht auszuüben. Konkret begünstigen diese Missbrauch, indem sie Menschen in Führungspositionen zu viel Macht geben und keine Transparenz, Rechenschaftspflicht und Kontrollmechanismen vorsehen. Oft gibt es zudem keine demokratische Legitimation. Ein solcher Machtmissbrauch kann auch zu Exklusion führen, bei der Menschen aus der Gemeinschaft ausgeschlossen oder in ihrer Mitarbeit eingeschränkt werden, wenn sie den moralischen Standards der Leitung nicht entsprechen. Diese Standards werden allerdings oft selektiv angewendet, wobei sexualethische Themen häufig im Vordergrund stehen, während andere ethische Themen wie z. B. der Umgang mit Geld oder Neid weniger Beachtung finden. In solchen Kontexten kann ein »Gemeindekodex« oder eine Gemeindekultur entstehen, der die Mitglieder dazu zwingt, sich bestimmten Regeln zu unterwerfen, um als vollwertige Christen anerkannt zu werden.
Diese Regeln spiegeln oft nicht die biblischen Lehren wider, sondern dienen dazu, die Kontrolle über die Mitglieder zu behalten.
Solche Strukturen sind nicht nur schädlich für das individuelle Glaubensleben, sondern können auch die gesamte Gemeinde in ihrer geistlichen Entwicklung behindern, werden aber oftmals viel zu spät erkannt, da Kritik häufig nicht akzeptiert und als mangelndes Gottvertrauen zurückgewiesen wird.
Präventionsstrategien, Schutzfaktoren und Aufklärung
Angesichts der weitreichenden und schädlichen Folgen von geistlichem Missbrauch ist es wichtig, präventive Maßnahmen zu ergreifen und Unterstützungsstrukturen für Betroffene, aber auch für ganze Gemeinden zu schaffen.
- Transparente Leitungsstrukturen: Gemeinden und Gemeinschaften sollten transparente und partizipative Leitungsstrukturen fördern, die die Macht nicht auf Einzelpersonen konzentrieren. Leitende Personen müssen Rechenschaft ablegen und für ihre Handlungen verantwortlich gemacht werden.
- Bildung und Aufklärung: Eine zentrale Strategie zur Prävention von geistlichem Missbrauch ist die Bildung von Gemeindemitgliedern. Durch Aufklärung über die Gefahren autoritärer Machtstrukturen und die Förderung eines gesunden, reflektierten Glaubens, können Gemeinden resilienter gegen Missbrauchsstrukturen werden. Dazu gehören auch Predigten und Schulungen in der Gemeinde.
- Sicherheitsmechanismen, Schutzkonzept und Beschwerdeverfahren: Es sollte klare und sichere Mechanismen geben, um Missbrauchsverdachtsfälle zu melden. Diese sollten unabhängig von der Leitung der Gemeinde sein, um Transparenz und Gerechtigkeit zu gewährleisten. Wichtig ist, dass es neutrale, nicht an Leitungsverantwortliche gebundene Ansprechpartner/innen gibt.
- Seelsorge und psychologische Unterstützung: Für Betroffene von geistlichem Missbrauch ist es essenziell, Zugang zu professioneller Seelsorge und psychologischer Unterstützung zu erhalten, um die erlittenen Schäden zu verarbeiten und ihre spirituelle und emotionale Gesundheit wiederherzustellen.
- Mündigen Glauben fördern: Ein mündiger Glaube, der Zweifel zulässt und offen für unterschiedliche Meinungen ist, kann als Schutzfaktor wirken. Es ist wichtig, sichere Räume zu schaffen, in denen offen über Glauben, Zweifel und persönliche Erfahrungen gesprochen werden kann. Ein solcher Glaube entwickelt sich nicht allein durch den regelmäßigen Gottesdienstbesuch, sondern benötigt Freiraum, um zu wachsen und sich zu entfalten. Die Förderung eines mündigen Glaubens erfordert eine Gemeindekultur, die nicht auf starren Regeln basiert, sondern Beziehungen zu Gott, zu Menschen untereinander und zur Umwelt im Blick hat.
- Kooperationen und Vielfalt fördern: Gerade im Umgang mit verschiedenen ethischen, theologischen und/oder politischen Meinungen wird Toleranz und Ambiguitätstoleranz eingeübt. Deshalb ist es wichtig, mit anderen Kirchen und Gemeinden und/oder auch mit anderen Vereinen aus der Stadt/dem Dorf (Sportverein, Feuerwehr etc.) zusammenzuarbeiten.
Geistlicher Missbrauch ist ein schwerwiegendes Problem, das tiefgreifende Auswirkungen auf die Betroffenen hat. Er entsteht oft durch eine Kombination aus ungesunden Strukturen, machtversessenen Theologien und dem Missbrauch von Autorität durch geistliche Führungspersonen. Die Aufgabe der Gemeinden ist es, Strukturen zu schaffen, die Machtmissbrauch verhindern, und einen Glauben zu fördern, der Resilienz und Mündigkeit unterstützt. Nur so kann der Glaube in seiner wahren Bedeutung – als Quelle der Kraft, des Trostes und der Hoffnung – erhalten bleiben.
Zum Autor: Dr. Tobias Faix ist Rektor der CVJM-Hochschule und Professor für Praktische Theologie. Er engagiert sich ehrenamtlich im kirchlichen Startup »UND Marburg« sowie als Landessynodaler in der EKKW.